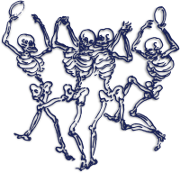| Danse macabre - Orgelkonzert
von Manuela Erlinger in der Danse macabre, das Orgelkonzert unseres Mitglieds Manuela Erlinger in der Stiftskirche Eisgarn, ist einem Genre gewidmet, das Künstler bis heute nicht loslässt: Wolfgang Sauseng, Professor an der Musikuniversität Wien, komponierte ein Stück über ein nächtliches Tanzfest, den Ballo per organo, in dem der Tod zur Tür hereintritt. Im Hamburger Totentanz, einem Gustostückerl für Freunde schräger Rhythmen und exzentrischer Ideen, zitiert Guy Bovet Für Elise, die Barcarole von Offenbach und das Leitmotiv aus dem Fliegenden Holländer, das beim Einfahren jedes Schiffes in den Hamburger Hafen erklingt. Petr Eben konzentriert sich im biblischen Tanz von Jephtas Tochter auf den Rhythmus, Volker Hopf lässt in seiner Toccata mit Totentanz die Zuhörer den tanzklappernden Schnitter Tod hören, Ernst Ludwig Leitners Totentanz beginnt leise und unruhig, und steigert sich zu einem überwältigenden Schluss, der plötzlich abreißt. Johann Nepomuk David schuf in der Partita eine beeindruckende Pedalfigur, die das Mähen des Sensenmanns darstellt, das bedrohlich immer näher rückt ... Manuela Erlinger, Jahrgang 1972, ist seit drei Jahren Stiftskapellmaestra des Kollegiatstiftes Eisgarn im Waldviertel. Sie studierte Kirchenmusik und das Konzertfach Orgel bei Prof. Michael Radulescu an der Universität für Musik in Wien. 1995 verbrachte sie ein Auslandssemester in Hamburg. Eine passionierte Organistin bittet "zum Tanz nach ihren Pfeifen" in das kleinste Stift Österreichs und präsentiert dabei ein faszinierendes Instrument: Die Orgel hat sich aus der Panflöte entwickelt. Sie galt als "sinnschmeichelnd" (Vitruv) und diente ursprünglich der Unterhaltung bei Gladiatorenkämpfen, Zirkusspielen und in den Herbergen leichter Mädchen. Kaiser Nero selbst trug sich mit dem Gedanken, als Orgelkünstler aufzutreten. 757 tauchte das Instrument erstmals in einem Gotteshaus auf. Pippin erhielt von Kaiser Konstantin neben vielen anderen Geschenken eine Orgel mit bleiernen Pfeifen, die in der Corneliuskirche in Compiége aufgestellt und angeblich von einem italienischen Priester gespielt wurde. Im 17. und 18. Jahrhundert fand die Orgel bei Tanz, Spiel und Festen der höfischen und bürgerlichen Gesellschaft Verwendung. Sie gehörte damals zum sogenannten "Frauengut", das bei der Heirat mitwanderte. Das Programm
Die Komponisten Volker Hopf (1931-2001) studierte in Berlin, Frankfurt und Göttingen. Er wirkte in Kassel als Stadthallenorganist und Musikkritiker. Sein bekanntestes Werk ist die Oper Zwerg Nase. In die Toccata mit Totentanz, auch Toccata media vita genannt, lässt er zahlreiche bekannte Motive einfließen, das Dies irae, ein fugiertes Media vita, den klappernden Schnitter Tod und schließlich das siegreiche Halleluja aus Christ ist erstanden. Ernst Ludwig Leitner (*1943) wurde bereits während der Gymnasialzeit mit der Musik des 20. Jahrhunderts vertraut gemacht. 1970 übernahm er den Bach-Chor in Wels, 1973 wurde er Leiter der Abteilung Musikpädagogik am Mozarteum in Salzburg und 1978 Hochschulprofessor für Tonsatz ebendort. Cesar Bresgen schrieb über ihn: "Das Erreichen einer Synthese klanglicher Farbwelt und überkommener polyphoner Gesinnung dürfte Leitners vornehmstes Anliegen sein." Den Totentanz komponierte er 1974 für Orgel. Später überarbeitete er ihn als Fassung für Streicher. Ein leiser, unruhiger Tanzbeginn steigert sich im Verlauf des Stückes bis zum überwältigenden Schluss, der plötzlich abreißt. Johann Nepomuk David (1895-1977) komponierte als Volksschullehrer zunächst autodidaktisch und studierte dann an der Wiener Akademie bei Joseph Marx. Nach zehnjähriger kirchenmusikalischer Tätigkeit in Wels, wo er unter anderem den Bach-Chor gründete, wurde er 1934 Kompositionslehrer am Leipziger Konservatorium und Leiter der dortigen Kantorei. Nach Kriegsende erfolgte die Berufung zum Direktor des Mozarteum Salzburg, später an die Stuttgarter Musikhochschule. Sein an die norddeutsche Tradition anknüpfendes 21-bändiges Choralwerk für Orgel (1932-1974) ist als stärkste schöpferische Leistung für diese Gattung seit Max Reger anzusehen. Den 10. Band dieser Reihe bildet die Partita Es ist ein Schnitter, heißt der Tod aus dem Jahr 1947, welche ein volkstümliches Lied und die gregorianische Sequenz Dies irae, dies illa in sieben Teilen verarbeitet. Zu Beginn, im Adagio, wird das Lied in der Pedalstimme vorgestellt, anschließend - Molto Moderato - wird es in den Oberstimmen frei zitiert. Das Andante ist als kurzer Triosatz angelegt, während im Allegro das Thema des Liedes nacheinander in den Manualoberstimmen und im Pedal verarbeitet wird. Der fünfte Satz, Dies irae, quantus tremor, tuba mirum, tremens factus sum ego, dies irae, erklingt als Bicinium und erinnert am Ende an die Organumfortschreitungen der mittelalterlichen Musik. Die Andante-con-moto-Variation ist die längste und wahrscheinlich beeindruckendste, da eine Pedalfigur das tanzende Mähen des Sensenmannes darstellt, welches immer bedrohlicher näherrückt, während sich darüber das Thema der Sequenz und der Liedmelodie erheben. Ein abklingender ruhiger Schluss bildet der siebte Satz, der nochmals beide Themen zitiert und kombiniert. Walter Kraft (1905-1977) studierte Komposition bei Paul Hindemith und wurde 1929 auf Lebenszeit zum Organisten der Lübecker Marienkirche berufen. Er war Direktor der Schleswig-Holsteinischen Musikakademie und der norddeutschen Orgelschule in Lübeck. Als begnadeter Improvisator interessierte sich Kraft für mittelalterliche Musik, welche besonders in seinen jüngeren Werken immer wieder durchschimmert. Sein Schaffen gipfelt in den großen oratorischen Kompositionen, unter denen Christus und Die Gemeinschaft der Heiligen die bedeutendsten sind. Zur Fortsetzung der Abendmusiken in St. Marien schuf er 1954 den Lübecker Totentanz - Der alte Gemäldefries nach Bernt Notke für zwei Chöre, Soli, 16 Soloinstrumente, Orgel und Tanzgruppe, den die Orgel mit der Totentanz-Toccata einleitet. Petr Eben (*1929) studierte Komposition an der Prager Akademie bei Pavel Borkovec. Schon während seiner Studienzeit machte er durch Kammer- und Vokalmusikkompositionen auf sich aufmerksam. Er lehrte am Royal Northern College of Music in Manchester und wurde schließlich zum Professor für Komposition an die Prager Musikakademie berufen. Eben komponierte zahlreiche Lieder, Kantaten, Oratorien, Chorwerke, Kammer- und Bühnenmusik. Eines seiner bevorzugten Instrumente ist die Orgel. Mit dem feierlichen Zyklus Sonntagsmusik erlangte er frühe Berühmtheit. Über seine 1992 uraufgeführten biblischen Tänze schrieb er: "Da mich von jeher das rhythmische Moment inspiriert hat, wählte ich das in der Orgelliteratur seltener angewandte Genre der Tänze." Den Text zum Tanz von Jephtas Tochter entnahm er dem Buch der Richter, in dem Jiftach das Gelübde ablegt, was immer ihm als erstes begegnet, als Brandopfer darzubringen, wenn er wohlbehalten von den Ammonitern zurückkehre. Es ist sein einziges Kind, das dem Vater zur Pauke tanzend entgegen kommt. Wolfgang Sauseng (*1956) studierte Komposition bei Anton Heiller und Erich Urbanner an der Musikhochschule Wien, außerdem Kirchenmusik, Orgel und Orchesterdirigieren. Seit 1977 ist er Organist an der Michaelerkirche, überdies Gründer und Leiter des Vokal- und Instrumentalensembles "Capella Archangeli". Ab 1989 unterrichtet er Tonsatz und kirchliche Komposition der Abteilung Kirchenmusik am Mozarteum Salzburg. Seit 1996 wirkt er als Professor an der Musikhochschule Wien. Sein Ballo per organo, geschrieben 1993, stellt ein großes, nächtliches Tanzfest dar, zu dem Wolfgang Sauseng der Film Viridiana von Louis Buñuel, Die Maske des roten Todes von Edgar Allan Poe und Texte italienischer Tanztheoretiker des 15. Jahrhunderts inspirierten. Neben Dignissime madonne treten bei diesem Fest auch rüde Gestalten und Bettler auf, die ein Sauflied von Pierre Attaignant anstimmen. Martin Luther schrieb 1524: "Mitten wir im Leben sind mit dem Tod umfangen." So tritt auch der Tod zur Tür herein, um sich eine kleine Weile mit den anwesenden Gästen im Tanz zu erfreuen. Guy Bovet (*1942) ist vorwiegend als Konzertorganist tätig. Er wirkt an der Stiftskirche von Neuchâtel, an der Basler Musik-Akademie sowie an der Universität von Salamanca. Außerdem ist er Mitglied der Schweizer Kommission für historischen Orgelbau. Über seine Trois préludes hambourgeois schreibt der Komponist: "Der Name kam zustande, weil das dritte Stück lange vor den beiden anderen komponiert worden war und ich von Anfang an die Absicht hatte, zwei andere zu komponieren; da es aber klar war, daß Hamburg einen Finalecharakter besitzt, spielte ich es fünfzehn Jahre lang unter dem Titel "Drittes". Als dann die beiden anderen Stücke fertig waren, mussten sie diese Staatsangehörigkeit auf sich nehmen, obschon sie mit Hamburg überhaupt nichts zu tun haben. Der Hamburger Totentanz entstand in einem Improvisationskonzert zu zweit mit dem Kollegen Hans Gebhard in einer Kirche der Hansestadt. Die Ostinato-Figur ist von einem Harmoniezyklus getragen, der sich immer wiederholt. Die Registrierungen bewirken ein Crescendo, einige spezifische Spezialklänge sind eingebaut, ebenso wie folgende Zitate: Barcarole von Offenbach, Für Elise und das Leitmotiv aus dem fliegenden Holländer, welches beim Einfahren jedes Schiffes in den Hamburger Hafen über die Lautsprecheranlage erklingt." Karten und Informationen Tel.: 0043 / 2863 / 30 26 Manuela Erlinger gibt seit 1986 Konzerte in Österreich, Deutschland, Rumänien, der Slowakischen Republik, Polen und Schottland. Im Juni 2002 erscheint ihre CD-Produktion "Walzer, Polka, Dancing Feet" für Orgel solo. Pressebetreuung marianne.schwach@web.de Das Kollegiatstift* Eisgarn liegt im Waldviertel und ist das kleinste Stift Österreichs. Die bewegte Geschichte der Propstei begann, als Johann von Klingenberg, Graf von Litschau, eine kleine Marienkirche im Dorf Eisgarn vergrößerte und mit Zustimmung des Bischofs von Passau um das Jahr 1330 zum Standort eines Kollegiatstiftes machte. Dem Auftrag des Gründers entsprechend sollte dort nicht nur die Seelsorge, sondern auch die Kultur besonders gefördert werden. Bereits 1393 ist die Existenz einer Stiftschule urkundlich belegt, die heute noch besteht. Die in den vergangenen Jahren renovierte Stiftskirche zählt heute zu den schönsten frühgotischen Kirchen des Waldviertels. An diese Tradition schließt der derzeitige Propst des Stiftes, Monsignore Ulrich Küchl, mit den Waldviertler Stiftskonzerten an. Die 1976 ins Leben gerufene Veranstaltungsreihe bietet ein umfangreiches Programm an klassischer und vor allem zeitgenössischer Musik sowie mehreren Ausstellungen. * Ein Kollegiatstift ist eine Gemeinschaft von Weltpriestern, die keinem Orden angehören, kein Gelübde abgelegt haben und das Stift auch wieder verlassen können. Als "Körperschaft des Öffentlichen Rechtes" kann es sich eine Verfassung, die "Stiftsstatuten" geben. Die Mitglieder eines Kollegiatstiftes, Kanoniker oder Chorherren genannt, sind meist Pfarrer in umliegenden Pfarrgemeinden. Letzte Aktualisierung: 09.09.2007 |
|
Europäische Totentanz-Vereinigung,
Thalheimer Straße 7, 06766 Bitterfeld-Wolfen |